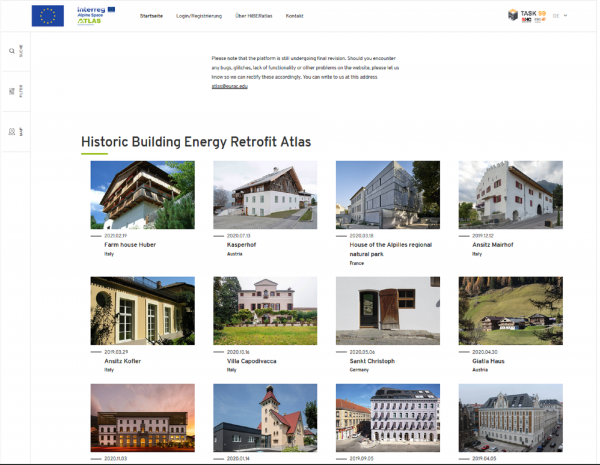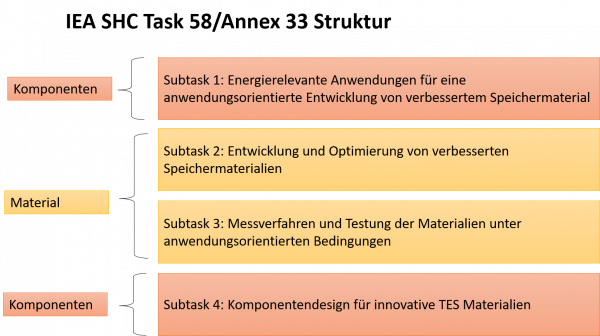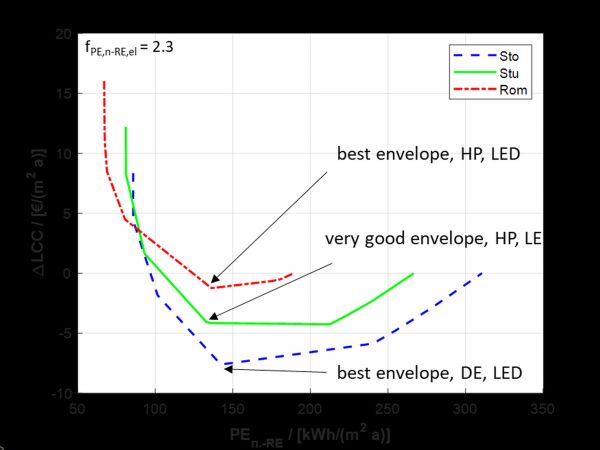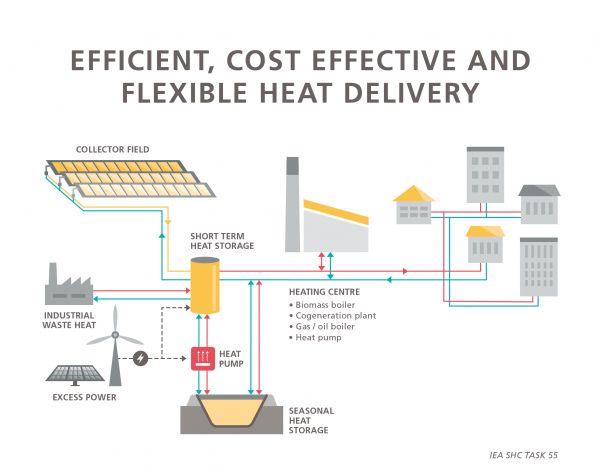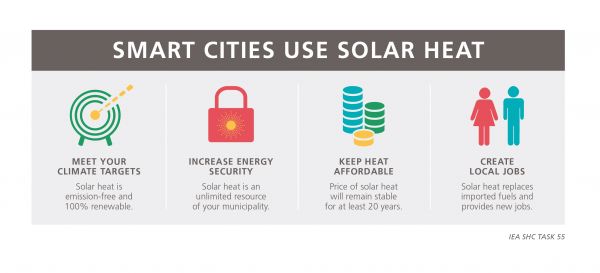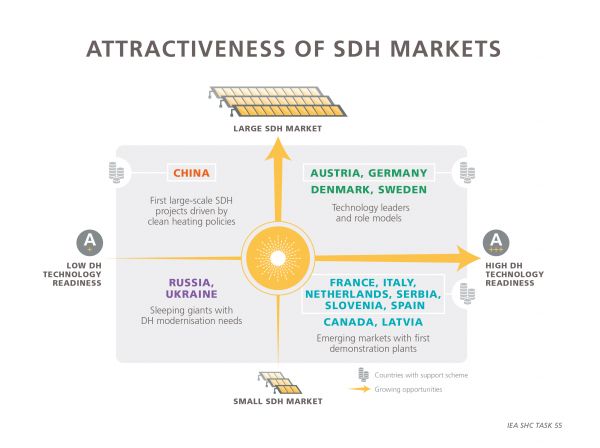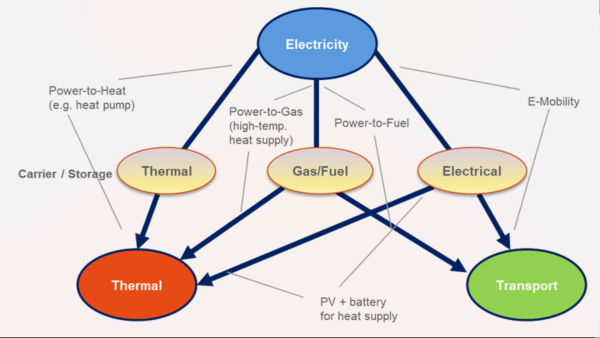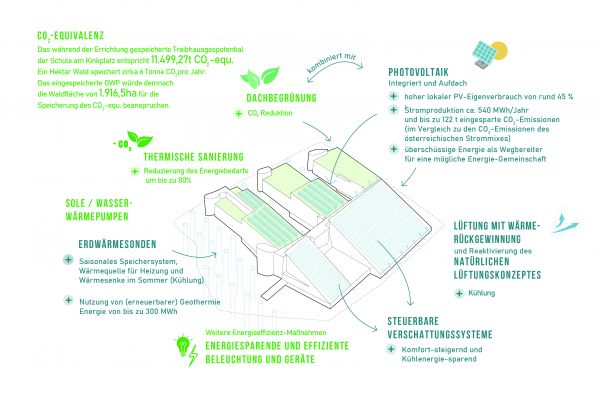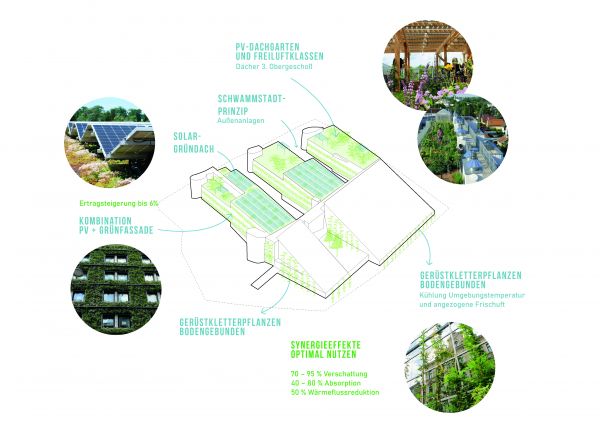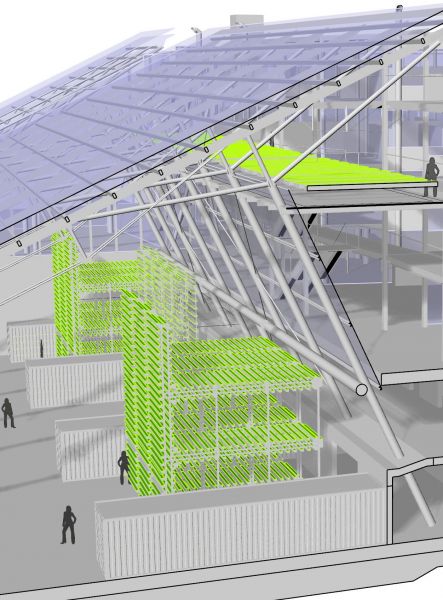Projekt-Bilderpool
Es wurden 410 Einträge gefunden.
Nutzungshinweis: Die Bilder auf dieser Seite stammen aus den Projekten, die im Rahmen der Programme Stadt der Zukunft, Haus der Zukunft und IEA Forschungskooperation entstanden sind. Sie dürfen unter der Creative Commons Lizenz zur nicht-kommerziellen Nutzung unter Namensnennung (CC BY-NC) verwendet werden.
Historic Building Energy Retrofit Atlas
Startseite der Datenbank www.HiBERatlas.com mit Best-Practice-Beispielen, die zeigen wie historische Gebäude saniert werden können, sodass eine hohe Energieeffizienz erreicht und gleichzeitig der Denkmalschutz respektiert wird.
Copyright: EURAC research Drususallee Bozen
Unabgedeckter PVT Kollektor
Unabgedeckte PVT Kollektoren in Sao Paulo (Brasilien) reduzieren den Gasverbrauch für die Warmwasserbereitung eines Hotels um 50 %
Copyright: www.2power.de
Vacuumröhren PVT Kollektor
PVT Kollektor aus Vacuumröhren auf der Südfassade eines Bürogebäudes der Universität Swansea
Copyright: Naked Energy Ltd
Übersicht Task 58 für Material und Komponentenentwicklung für kompakte Wärmespeicher
Die Grafik zeigt die Übersicht und Inhalte des IEA SHC Task 58 für Material- und Komponentenentwicklung für kompakte Wärmespeicher. Der Task ist in 4 Subtask gegliedert die sich mit der Definition von Randbedingungen, Entwicklung von TCM und PCM Materialien, Testmethoden und Komponentendesign von kompakten Wärmespeichern beschäftigt.
Copyright: AEE INTEC
life cycle cost
Linien mit dem geringsten Unterschied bei den Lebenszykluskosten je nicht-erneuerbarer Primärenergie verschiedene HLK-Konfigurationen und BIPV im Bürogebäude in Stockholm (Sto), Stuttgart (Stu) und Rom. LCC umfasst Investitionen, Wartung und Betrieb über einen Zeitraum von 20 Jahren. HP steht für Wärmepumpe und DE für Direktelektrisch.
Copyright: Universität Innsbruck
Solare Fernwärme mit Strom-Wärme-Kopplung
Schema eines Fernwärmesystems mit Wärmeeinspeisung aus zentralen solarthermischen Kollektoren, Industrie-Abwärme, Heizzentrale, Wärmepumpe und mit Kurzzeit- und saisonalem Wärmespeicher. Quelle der Wärmepumpe ist der saisonale Speicher. Überschussstrom aus PV- und Windanlagen wird für den Betrieb der Wärmepumpe verwendet.
Copyright: IEA SHC Task 55 und European Copper Institute
Solarwärme in Smart-Cities
Auflistung der wesentlichen Vorteile der Solarwärme: sie ist emissionsfrei und zu 100% erneuerbar, sie erhöht die Versorgungssicherheit, der Preis ist bezahlbar und bleibt über 20 Jahre konstant, sie ersetzt importierte Energieträger und bietet neue Arbeitsplätze.
Copyright: IEA SHC Task 55 und European Copper Institute
Attraktivität der Märkte für solare Fernwärme
Diagramm mit 4 Bereichen je nach Technologiereife der Fernwärme (gering bzw. hoch) und Markt für solare Fernwärme (klein bzw. groß). Im Bereich geringe Reife und kleiner Markt befinden sich Russland und Ukraine; im Bereich geringe Reife und großer Markt befindet sich China; im Bereich hohe Reife und kleiner Markt befinden sich Frankreich, Italien, Niederlande, Serbien, Slowenien, Spanien, Lettland; im Bereich hohe Reife und großer Markt befinden sich Deutschland, Österreich, Dänemark, Schweden, die Technologieführer und Vorreiter sind.
Copyright: IEA SHC Task 55 und European Copper Institute
TCM-Speichersystem-Prototyp im Container zur Integration in ein Einfamilienhaus
Das Bild zeigt ein TCM-Speichersystem mit 3 Modulen in Kombination mit einem Wärmepumpensystem und 2 m³ Pufferspeicher, installiert in einem Container als komplettes Speichersystem. Der Container wird zu einem Einfamilienhaus in Warschau transportiert und neben dem Haus installiert, um überschüssige Solarthermie aus dem Sommer zu speichern und im Winter für die Raumheizung zu nutzen
Copyright: AEE INTEC
Passys Testzelle
Messung der Leuchtdichte einer Solaren Fassade in der Passys Testzelle der UIBK
Copyright: Bartenbach GmbH
Diagramm des Flexibelen Sektorkopplungsmodells (FSC Model)
Das Energiesystem für Elektrizität besteht aus den Sektoren Elektrizität, Transport und Wärme. Erzeugte Elektrizität wird zu den Bedarfsarten Wärmeanwendungen und Transport geführt, entlang den Pfaden Thermische Energie, Treibstoffe und Elektrizität.
Copyright: IEA ES TCP Task35
Erdbeckenspeicher Dronninglund (DK)
Der Erdbeckenspeicher in Dronninglund, Dänemark, mit einem Volumen von 60.000 m3, speichert solare Wärme und Wärme einer Wärmepumpe.
Copyright: Fjernwärme Dronninglund
IEA ES Task 45 Expert:innen beim Hechingen Erdbeckenspeicher
Der Erdbeckenspeicher in Hechingen, Deutschland, wurde schon ausgegraben. Der Speicher wird 2025 vollendet und an das Fernwärmenetz von Hechingen angeschlossen.
Copyright: AEE INTEC, Wim van Helden
Die ehemalige Schule am Kinkplatz bei Nacht
Als Demonstrationsprojekt für das Sondierungsprojekt GreenTech-Renovation dient die Schule am Kinkplatz von Helmut Richter, da bei diesem Gebäude exemplarisch sehr viele Themen zur sinnvollen energetischen Sanierung bearbeitet werden konnten.
Copyright: Mischa Erben
Vorteile einer energetischen Sanierung am Beispiel Schule am Kinkplatz
Die Übertragbarkeit des Projekts trägt dazu bei, die Renovierungswelle zu beschleunigen und konzentriert sich besonders auf schwierige Gebäude mit hohem Energieverbrauch. Die Strategien und Erkenntnisse aus GreenTech-Renovation lassen sich auf alle Gebäude aus den letzten 70 Jahren mit hohen Glasanteilen und mit intelligenten Anpassungen noch weiter übertragen.
Copyright: GreenTech-Renovation Konsortium
Begrünungskonzept des Demonstrationsobjekt Schule am Kinkplatz
Ergänzend zum Klima- und Energiekonzept und dem Nutzungskonzept werden mit Begrünungsmaßnahmen an der Fassade, am Dach und im Innenraum wirksame Synergien geschaffen. Mit innovativer und abgestimmter Einbeziehung von Vegetation kann das Leistungspotential der Gebäudeoptimierung und der energetischen Maßnahmen gesteigert werden.
Copyright: GreenTech-Renovation Konsortium
Vertical Farming Konzept für das Demonstrationsobjekt Schule am Kinkplatz
Im Zuge des Sondierungsprojektes entstand die Idee, die Schule am Kinkplatz als Ausbildungsstätte für künftige Urban Farmer oder Vertical Farmer zu nutzen. Besondere Bedeutung wird der Möglichkeit zugeschrieben, die Lebensmittelproduktion als zentralen Bestandteil einer übergeordneten typologischen Weiterentwicklung des Bestandsgebäudes als Ausbildungszentrum für urbane vertikale Landwirtschaft zu sehen. Damit erhält die Schule am Kinkplatz ein weltweites Alleinstellungsmerkmal.